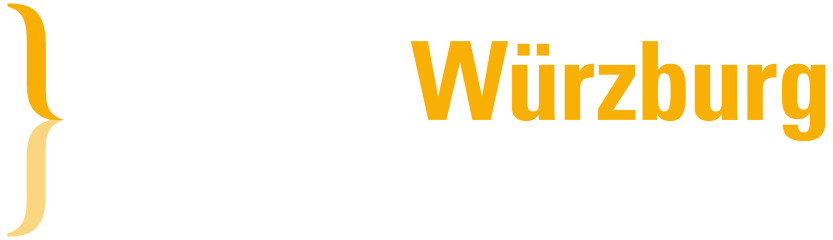Am Anfang seiner Regierung stand Adalbero ganz auf Seiten von Kaiser Heinrich III., der selbst Kontakt zu den Reformern hielt und „ganz im Bannkreis der kirchlichen Kultur und der christlichen Sittenlehre stand" (Klaus Wittstadt). 1051 trat Adalbero sogar neben Abt Hugo von Cluny als Taufpate des späteren Heinrich IV. auf. Nach dem Tod Heinrichs III. intensivierte er sein Engagement auf Reichs- und Hoftagen sowie Synoden und war ein gefragter Ratgeber und Schlichter. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass Adalbero sich dem jungen Heinrich IV., der beim Tod des Vaters gerade mal sechs Jahre alt war, anfangs freundschaftlich verbunden fühlte; so hielt er sich häufiger am Königshof auf und traute Heinrich 1066 schließlich mit Bertha von Savoyen.
Die Kaisertreue Adalberos währte bis zum Bruch Heinrichs IV. mit dem Papst, was als Investiturstreit in die Geschichtsbücher einging. Es ging dabei um die Frage, ob Kaiser oder Papst das Recht zustand, einen neuen Bischof zu investieren (einzuführen) – eine Frage, die Reich und Christenheit bis ins Mark erschütterte. Trotz seiner engen Verbindungen zum Königshaus stellte sich Adalbero 1076 mit allen Konsequenzen auf die Seite von Papst Gregor VII. Gregor, ebenfalls ein Anhänger der kirchlichen Reformbewegung, wandte sich gegen die gängige Praxis, dass die Bischöfe vom Landesherrn und nicht vom Papst eingesetzt wurden. Der erbitterte Kampf zwischen Kaiser und Papst beherrschte in der Folge nicht nur Adalberos Leben, sondern die gesamte Machtpolitik jener Zeit.
Im Glauben, den Streit gewaltsam beenden zu können, erklärte Heinrich IV. im Januar 1076 auf der Synode von Worms Papst Gregor VII. für abgesetzt. Unter den Anwesenden sollen nur Adalbero und Hermann von Metz Einspruch erhoben haben. Daraufhin verhängte Papst Gregor über König Heinrich den Kirchenbann, worauf dieser sich auf den berühmten „Gang nach Canossa" (Januar 1077) machte. Damit war die Abhängigkeit der Bischöfe vom König erneut festgeschrieben.
Unerschütterlicher Kämpfer für Kirche und Papst
Adalbero aber ließ sich nicht auf Kompromisse ein, er wollte das ottonisch-salische Reichskirchensystem beendet sehen. 1077 rief er in Forchheim gemeinsam mit anderen den Schwabenfürsten Rudolf von Rheinfelden zum Gegenkönig aus. Die Würzburger Bürger jedoch waren König Heinrich treu geblieben und verhinderten Adalberos Rückkehr in die Stadt. Rudolf und Adalbero versuchten die Stadt zwar durch Belagerung einzunehmen, scheiterten jedoch. Heinrich IV. ernannte einen Gegenbischof für Würzburg (Bischof Eberhard). Im August 1078 nahm Adalbero an der Schlacht von Mellrichstadt teil, in der Kaiser Heinrich IV. und Gegenkönig Rudolf von Schwaben aufeinander trafen. Der Kaiser schlug einen Teil des gegnerischen Heeres in die Flucht, musste aber den Rückzug nach Würzburg antreten. Im Frühjahr 1085 wurde Adalbero – wie alle anderen Bischöfe auf Seiten Gregors – von der Mainzer Synode für abgesetzt erklärt und musste in die Verbannung gehen.
1086 konnte Adalbero kurz nach Würzburg zurückkehren, wo er aber bald erneut vertrieben wurde. Alle Vermittlungs- und Kompromissvorschläge – Heinrich IV. soll ihm nochmals das Bistum angeboten haben – lehnte Adalbero rigoros ab. „Die Quellen berichten über sein Verhalten, dass er eher gefangen oder getötet werden wollte, als vor den Kaiser zu treten und mit ihm zu sprechen." (Klaus Wittstadt / Wolfgang Weiß)
Also verließ Adalbero Würzburg und zog sich in das von ihm gegründete Kloster auf seinem Stammsitz Lambach zurück. Am 6. Oktober 1090 starb er dort und wurde in der von ihm selbst in Auftrag gegebenen und 1089 geweihten Abteikirche bestattet.