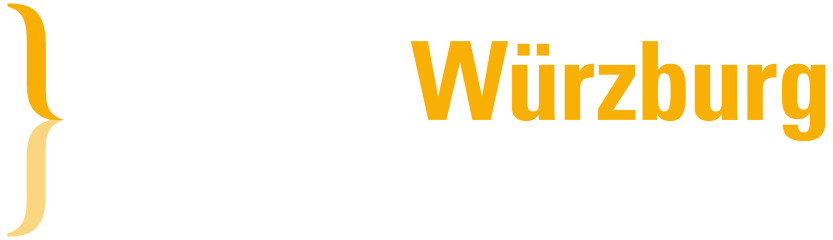Weitaus blumiger erzählt eine weit verbreitete Sage von dieser Klostergründung: So soll Hadeloga eines Sommertages bei ihrem Bruder Pippin III. dem Jüngeren (Pippin der Kurze) auf dem Schwanberg gestanden haben und in das Maintal hinab geblickt haben. Die Lieblichkeit der Landschaft beeindruckte sie und so beschloss sie ein Kloster zu gründen. Hadeloga warf ihren Schleier in den Wind; dort, wo der Schleier zu Boden fallen würde, wollte sie ihr Kloster errichten. Der Schleier flog gen Westen, bis ihn ein Schäfer namens „Kitz" (Kuccingus) am Ufer des Mains gefunden haben soll. Dort erbaute Hadeloga ihr Kloster und nannte es zu Ehren des Schleierfinders „Kitzingen".
Die Klostergründerin selbst wurde – so heißt es weiter – zur ersten Äbtissin des Benediktinerinnenklosters. In besonderer Weise habe sich Hadeloga um die Armen, Kranken und Notleidenden gekümmert. Der gute Ruf des Klosters und die guten Taten seiner Gründerin sollen auch Karl Martell zu Ohren gekommen sein, der sich schließlich kurz vor seinem Tod mit seiner Tochter aussöhnte und das Kloster mit Gütern und Schenkungen bedachte.
Hadeloga starb vermutlich um 750 und wurde in Kitzingen beigesetzt.
Dichtung und Wahrheit
Betrachtet man die legendäre Gründungsgeschichte mit den Augen des Historikers, ergeben sich einige Ungereimtheiten: So gab es um 745 noch kein Schloss auf dem Schwanberg, der erste Burgenbau wurde um 1250 errichtet. Zudem stammte Hadeloga wohl kaum aus dem Königsgeschlecht der Karolinger; auch Karl Martell, der legendäre Vater Hadelogas, ist bereits 741 gestorben; dass Hadeloga dennoch in das Adelsgeschlecht der Karolinger eingereiht wurde, ist wohl als seinerzeit häufig verwendetes Mittel zur Glorifizierung und politischen Legitimierung der Heiligen zu interpretieren.
Dennoch geht die Forschung auch weiter von der realen Existenz Hadelogas aus. Möglich ist beispielsweise ein Zusammenhang mit Hruadlaug, die 762/763 als Äbtissin urkundlich bezeugt ist (Franziskus Büll).
Ein wichtiges historisches Zeugnis über Hadeloga und zugleich der früheste schriftliche Beleg für das Kloster ist die „Vita Sturmi", eine Lebensbeschreibung des ersten Fuldaer Abtes Sturmius, die um das Jahr 800 von einem seiner Nachfolger, nämlich Abt Eigil von Fulda, verfasst wurde. Hier wird berichtet, wie Sturmius 748/749 wegen einer Erkrankung in einem „monasterium" (Kloster) „apud chizzinga" (bei Kitzingen) Station machte; dem Kloster stand Hadeloga als Äbtissin vor. Da das Kloster wohl bereits einige Jahre vor dem Besuch Sturmius' errichtet worden war, nennt die Stadt Kitzingen heute das Jahr 745 als ihr Gründungsjahr und Hadeloga ihre Gründerin.
Erich Schneider bezeichnet die verkehrsgünstige Lage am Main als eine der Hauptursachen für die frühe Klostergründung; außerdem betont er die Rolle der jungen Abtei in der von Bonifatius durchgeführten kirchlichen Neuordnung Ostfrankens: So habe Bonifatius „die Neugründung nach den Regeln des heiligen Benedikt reformiert und die heilige Thekla als Äbtissin neben der Gründerin Hadeloga eingesetzt".
Auch Klaus Wittstadt und Wolfgang Weiß heben die engen Beziehungen zu Bonifatius hervor, der das noch junge Christentum in Franken durch die Gründung von Frauenklöstern vertiefen wollte: „Frauenklöster in Tauberbischofsheim sowie in Kitzingen und (Klein-)Ochsenfurt am Main, die möglicherweise schon vor Bonifatius bestanden haben, werden unter die Leitung Liobas und Theklas gestellt und im Geiste der Benediktsregel reformiert. Für das Kloster Kitzingen nennt die Legende die hl. Hadeloga, eine angebliche Tochter Pippins des Jüngeren, als Stifterin."